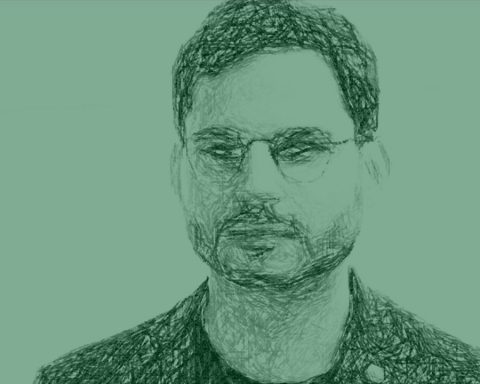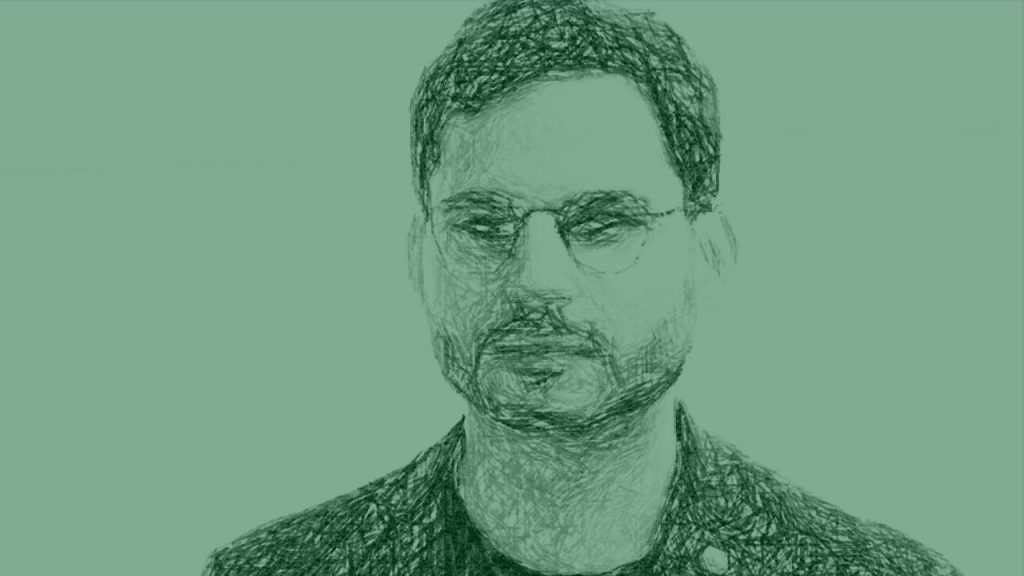Wie ich ins Krankenhaus gekommen bin, hab’ ich schon geschildert („Das Mädchen in der Rettung“). Nun saß ich also auf einem der hölzernen Klappsessel an der Aufnahme und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Und sie kamen: Größe messen, wiegen, Blutdruck und was derlei Scherze mehr sind. Schließlich fand ich mich doch in einem Zimmer wieder, alleine – ich hatte ein Einzelzimmer bekommen, warum ist mir nicht bekannt, zugestanden wär’s mir nicht.
Aber wie auch immer: Ich schaffte es ins Bett, und da lag ich nun, hing an irgendeiner Flasche und – schlief. Tatsächlich sollte das für die nächste Zeit meine Hauptbeschäftigung werden. Dank der Infusionen, möglicherweise auch noch anderer Medikamente (ich kann mich nicht erinnern) verbesserte sich mein Befinden schnell: wesentlich weniger Schwindel, die Übelkeit war auch weg. Ich konnte essen wie zuvor. Lediglich die Schwäche blieb, und die Müdigkeit. Aber ich hatte ja nichts zu tun. Ich schlief und erfreute mich meines Appetits.
Die Damen und Herren Doctores steckten mich ins CT, und da entdeckten sie die Ursache meines elenden Zustandes: Metastasen im Kopf. Das war nun doch ein bisschen ein Schock. Aber die Fachleute beruhigten mich: Keine große Affäre, ich würde Bestrahlungen bekommen, die Aussichten seien gut.
Also auch das noch, zu Krebs und Chemotherapie dazu. Aber schön. Ich ergab mich in mein Schicksal oder genauer: ich begab mich vertrauensvoll in die Hände der Ärztinnen und Ärzte. Sowohl mit Bestrahlungen als auch mit Chemotherapien sollte allerdings noch zugewartet werden. Zuerst müsse ich mich erholen, müsse sich mein Gesamtzustand verbessern, wie’s hieß.
Und so befand ich mich also in meinem Zimmer und hatte nichts weiter zu tun als eben dies: Zustand verbessern. Keine sehr schwierige Aufgabe. Es versteht sich von selbst, dass mir in diesen Tagen und Wochen so allerlei im Kopf herumging. Wenn ich erwartet hatte, es würde sich eine schmerzliche Auseinandersetzung mit meiner Vergangenheit entspinnen, mit meinen Taten und Missetaten, dann hatte ich mich allerdings getäuscht. Zu meiner Überraschung standen plötzlich zwei Felsbrocken in meinem Bewusstsein, keine Ahnung, woher sie kamen, früher hatte ich über derlei Dinge nie nachgedacht. Doch die Felsbrocken standen da, unbeweglich und undurchdringlich.
Der eine, kleinere, äußerte sich in einem erleichterten Seufzer: Gott sei Dank bin ich schon siebzig!
Gemeint war: Da konnte mir niemand mehr vorwerfen, ich stehle mich zu früh davon. Nicht einmal ich selbst. Andernfalls hätte ich mir nämlich Vorwürfe gemacht, dass ich zu wenig auf meine Gesundheit geachtet hätte, man weiß schon: Rauchen, zu wenig Sport, all das. In Tirol spielt derlei bekanntlich eine besonders wichtige Rolle, man muss fit sein, fit bleiben, das ist so was wie das Oberste Gebot, da gibt es kein Pardon. Der Stand der jeweils individuellen Fitness ist viel wichtiger als alle sonstigen Leistungen, und seien sie noch so herausragend. Selbst der Philosoph, der Musiker oder der Mediziner wird zunächst einmal nach seinen körperlichen Leistungen beurteilt – Berg-, Schi- und Radtouren –, weniger nach dem, was er oder sie eigentlich leistet. Unser Kollege Walter Klier hat das einmal unnachahmlich scharf gefasst: Der Tiroler (in diesem Falle schrieb er über die Innsbrucker, aber das macht keinen Unterschied) – der Tiroler oder die Tirolerin also sei „stets auf das Peinlichste um die eigene Leistungsfähigkeit besorgt und, mit einem unmerklich raschen Seitenblick, die der anderen.“
Dieser unmerklich rasche Seitenblick, der erscheint mir charakteristisch für das Leben hierzulande. Ich hätte ihn, wäre ich in jüngeren Jahren erkrankt, sehr empfindlich gespürt – schmerzhaft sogar. Das war mir erspart geblieben. Ich hatte mein Teil beigetragen, ich hatte genug Geld nach Hause gebracht – genauer natürlich: es war genug Geld auf mein Bankkonto und von dort auf unsere Sparbücher geflossen –, ich hatte genug geleistet. Von daher konnte mir niemand einen Vorwurf machen, nicht einmal ich selbst. Das war immerhin auch etwas wert.
Der große Block, das war hingegen mein Leben. Der stand in meinem Bewusstsein, mächtig und dräuend, vor allem aber: unbeweglich, unbewegbar. Mein Leben war gelebt, so wie ich’s gelebt hatte, da gab es nichts mehr zu rütteln, nichts mehr zu ändern. Selbst wenn ich gesund geblieben wäre: Was auch immer ich noch getan oder unterlassen hätte, es hätte nichts mehr geändert an diesem Leben. Es stand einfach da. Zwecklos, sich dagegen zu wehren.
Natürlich erhob sich die Frage, wie dieses Leben nun zu beurteilen sei. Gelungen? Verpfuscht? Nun, auch zu diesen Fragen stellte sich eine spontane Antwort ein, aus meinem Inneren heraus, ohne vorherige Abwägung, ohne Kalkulation. Die Antwort lautete: teils–teils. Ich hatte nichts Besonderes vorzuweisen, weder als Schriftsteller, geschweige denn als Lehrer. Allerdings hatte ich mir auch nichts besonders Schlimmes zuschulden kommen lassen. Ein Engel, ein Heiliger war ich natürlich nicht, aber wirklich böse, zerstörerisch gar? Nein, das auch nicht. Hoffte ich zumindest.
Ein klassischer Spießer also. Langweilig. Und tatsächlich leiden solch durchschnittliche Leben unter einem schlechten Ruf. Man denke bloß an unsere hehre Literatur. Vergessen wird dabei, dass selbst das durchschnittlichste, das unspektakulärste Leben erst gelebt werden muss. Jeden Tag in der Früh aufstehen. Das sagt sich so leicht, aber für einen Nacht- oder besser: Abendmenschen bedeutet das jeden Morgen eine kleine Qual. Die kann nicht weggeleugnet werden. Ein Arbeitsleben lang. Und am Abend rechtzeitig das Licht ausschalten, rechtzeitig schlafen. Als ich in Pension gehen durfte, zählte dies zu den größten Erleichterungen: nicht mehr so früh aufstehen zu müssen.
Und dann die Arbeit. Auch nicht immer ein Honiglecken. Die Vorgesetzten, die Kollegen. Die Kunden. Die Routine – die macht ja so unheimlich müde. Davon ist kaum jemals die Rede. Außerdem gibt’s noch die Familie, die Kinder. Was die Kopfzerbrechen bereiten können! Und nicht nur das: ausgesprochene Sorgen, Herzweh.
So banal das alles aus der erhabenen Sichtweise von Philosophen, Schriftstellern, Künstlern oder Historikern sein mag – für die Beteiligten ist es ernst, fürchterlich ernst, existenziell geradezu. Deshalb ist das Leben von uns Spießern auch keineswegs langweilig, wie das immer unterstellt wird. Oh nein! Ich kann von mir selbst sagen, dass mein Leben stets aufregend war, deshalb verging’s ja auch so schnell, immer irgendetwas zu erledigen, zu bewältigen, irgendwelche Probleme zu lösen. Ich hätt’ oft was drum gegeben, wenn es ein bisschen langsamer verlaufen wäre – ein bisschen langweiliger. Da hätt’ ich nichts dagegen gehabt.
Also: Jedes Leben muss erst gelebt werden, selbst das unansehnlichste, das spießigste. Doch wie gesagt: So einfach, wie man sich das vorstellt, ist es nicht, es bedarf ein gerüttelt Maß an Disziplin, ja sogar Anstrengung. Und deshalb kann jedes dieser Leben auch daneben gehen. Wir beobachten das hin und hin. Ehekrach, Scheidung. Der Mann, der anfängt zu saufen. Die Frau, die ihr Leben nicht bewältigt, lebt von der Fürsorge, wir sehen sie mit dem Buggy rauchend vorm Einkaufszentrum stehen. Auch sie trinkt zu viel. Wir schauen auf solche Leute hinunter; heimlich vielleicht, versteckt, aber doch. So ein bisschen zumindest. Dabei führen sie uns bloß vor Augen, wie’s ebenso gut (oder schlecht) hätte kommen können, wie’s jederzeit kommen kann. Man soll sich bloß nichts einbilden.
Andererseits dürfen wir das Spießige schon auch auf der Habenseite verbuchen. Von selber geht wie gesagt gar nichts. Na ja – jedenfalls hab’ ich mir mein geordnetes Leben selbst gut geschrieben. Und deshalb bin ich zu dem Ergebnis gekommen, es sei unterm Strich teils gut, teils weniger gut gelungen. An missglückten Episoden herrschte ja kein Mangel: Gelegenheiten, bei denen ich kläglich versagt hatte, das Falsche gesagt hatte, peinlich peinlich, sogar unnötig bös’ gewesen war, oder zumindest egoistisch. Solche Erinnerungen ließen mich in der Nacht hochfahren: Wie konntest du nur? Entsetzlich! Trösten konnte ich mich bloß mit der positiven Substanz meines Lebens. Die negativen Erinnerungen stachen allerdings hervor, sie stachen ins Fleisch. Das war nicht zu umgehen.
In diesem Zusammenhang stellte sich noch eine Erkenntnis ein: Wann immer ich mir vorzustellen versuchte, wie ich in einer gegebenen Situation hätte anders handeln sollen, mich anders entscheiden, und wie mein Leben dann vielleicht hätte ausschauen können – wann immer ich mich solchen Gedankenspielchen hingab, gelangte ich rasch zu der ernüchternden Einsicht, dass ich in so einem Falle hätte ein anderer Mensch sein müssen. So, wie mein Leben verlief, repräsentierte es meine Persönlichkeit. Anderes Leben? Andere Persönlichkeit, bitte. Woraus sich umgekehrt der zwingende Schluss ergab, mein Leben sei das Produkt meines Ich, meines Wesens.
Da steckt natürlich ein gerüttelt Maß an Fatalismus drin, und ich bin – wie gesagt, aufgrund spontaner Erkenntnis, aus dem Bauch heraus – geneigt, diesen Fatalismus zu teilen. Als ich jedoch der treuen Begleiterin und Behüterin meines Lebens gegenüber eine einschlägige Andeutung machte, da reagierte sie ungehalten. Und es stimmt schon: Sie gibt sich nicht so leicht zufrieden. Man sieht: Genügend Raum für individuelle Meinungen und Auffassungen!
Die Lebensabrechnung also: Teils–teils. Wie schon gesagt, stellte sich das Ergebnis dieser Abrechnung spontan ein, keineswegs aufgrund einer minutiösen Kalkulation. Dafür standen die Ergebnisse aber auch fest, konnten nicht durch Nachdenken, durch innerliche Argumentation verändert werden. Ich akzeptierte sie, sie wurden zur festen Grundlage meines Denkens, meiner Welt- und Selbstsicht; so sehr, dass ich nicht mehr darüber nachzudenken brauchte.
Womit ich mich anderen Dingen zuwenden konnte. Meiner Lage, zum Beispiel.
Unmittelbar nachdem ich ins Krankenhaus gekommen war, begann der erste Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie. Der war ziemlich streng, wie man sich vielleicht erinnern wird, kam praktisch einer Ausgangssperre gleich. Als ich mit der Rettung ein paar Mal nach Innsbruck gebracht wurde zu diversen Untersuchungen, da erschreckten mich die menschen- und autoleeren Straßen. Das ergab ein gespenstisches Bild.
Damals wussten wir noch sehr wenig über diese neue Krankheit. Selbst wenn man selbst nicht dazu neigte, der Panik zu verfallen, konnte man doch nur spekulieren. Im Krankenhaus galt nicht bloß Maskenpflicht – nicht im Zimmer, sehr wohl aber am Gang –, sondern auch Besuchsverbot. Strenges Besuchsverbot. Nicht einmal Taschen durften zugestellt werden, Pakete mit Wäsche zum Beispiel. Absolut nichts.
Für mich ergab sich folgende Aufgabe: Zunächst hatte ich mich mit meiner Krankheit herumzuschlagen, mit dem Krebs. Ich musste begreifen, was mit mir geschah, musste mich damit abfinden, es akzeptieren, wenn möglich. Musste meine Perspektive drauf einstellen, die Erwartungen, die Pläne. Das war an sich schon nicht leicht. Fachkundige Stimmen sagten mir, so ein Lungenkrebs sei heutzutage kein Todesurteil mehr, da könne man noch recht lange vergnügt leben. Eine dieser Stimmen war ein Neffe, der in Linz an der Radiologie arbeitete. Doch kamen die Stimmen auch aus anderen Zweigen unserer teilweise doch recht medizinischen Familie.
Das war tröstlich. Ich konnte diesbezüglich einigermaßen optimistisch sein. Sogar in Bezug auf die bevorstehenden Chemotherapien sprach man mir Mut zu – das sei heute längst nicht mehr so brutal wie früher, besonders der Übelkeit sei man Herr geworden, da sei also auch nicht so viel zu befürchten.
Ich war geneigt, diesen Stimmen zu glauben. Was meinen Krebs betraf, fühlte ich mich folglich eher zuversichtlich. Eine böse Krankheit, gewiss, und letztlich sicher letal, aber vorläufig sah ich mich noch darüber hinaus, sie einigermaßen zu bewältigen, ohne mir selbst und vor allem ohne anderen allzu sehr zur Last zu fallen.
Nun kam aber Corona dazu. Ich kam mir vor, als säße ich mit meinem Krebs-Problem in einer riesigen Hohlwelle, rund herum drehte sich ein weiteres Werkel, die Pandemie. Wie schon gesagt, wusste man damals nicht viel darüber. Äußerst ansteckend, klar, die Zahlen waren furchterregend. Gegenmittel? Impfung? Da machte man uns keine Hoffnung. Da war nichts in Sicht, das würde noch Jahre dauern. Bis dahin half nur Abstand halten, Hände waschen – in England lehrten sie die Kinder, dabei „Happy Birthday“ zu singen, damit sie lange genug am Waschbecken blieben – und vor allem Masken tragen. Aber das waren, wie mir völlig klar war, nur Notmaßnahmen.
Die Krankheit würde sich also ausbreiten, und auch für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis ich mich anstecken würde. Und je länger es mir gelang, diesen Zeitpunkt hinauszuschieben, desto näher würde er rücken, desto sicherer würde er kommen. Aufgrund meiner Erkrankung musste ich mit einem schweren Verlauf rechnen. Was man von einem solchen hörte, das ließ das Blut in den Adern gefrieren. Ich lebte, so gesehen, auf Abruf. Wie lange noch? Ein halbes Jahr? Ein Jahr? So weit wagte ich gar nicht voraus zu denken.
Ein Leben auf Abruf. Ich versuchte, nicht allzu viel darüber nachzudenken, vor allem nicht über den Verlauf einer schweren Covid-Erkrankung. Da konnte ich nur auf ein mildes Schicksal hoffen. Im Übrigen galt es, vorläufig weiter zu leben, einen Tag nach dem anderen, eine Vorsichtsmaßnahme nach der anderen. Immerhin versuchte ich, meine Angelegenheiten soweit als möglich zu ordnen, für den Fall, dass das Ende plötzlich kommen sollte. All die Arbeiten, die ich am Computer erledigt hatte: Korrespondenz, Bank, Buchhaltung.
Wenn ich aus heutiger Sicht auf jene finsteren Wochen zurückblicke, dann spielt jedoch etwas anderes eine herausragende, eine übermächtige Rolle: das Krankenhauspersonal. Gemeint sind damit wirklich alle, vom Oberarzt über Krankenschwestern und Pfleger (warum sagen wir eigentlich nicht einfach Krankenbrüder?) bis hin zu den Damen, welche das Essen brachten oder Zimmer und Bad reinigten. Dass sie alle tüchtig waren, ihren Job professionell erledigten, das mochte man vielleicht noch als selbstverständlich voraussetzen. Ich tat’s nicht. Ich war dankbar dafür. Aber das war ja noch gar nicht alles. Wenn ich mich bei den Leuten bedankte, dann antworteten sie stets: „Das ist unser Job.“
„Sicher“, gab ich zurück. „Aber man kann jeden Job so oder so machen.“
Und sie machten ihren Job eindeutig so: effizient, aufmerksam, mitdenkend, initiativ. Vor allem aber freundlich, immer freundlich, um nicht zu sagen: fröhlich. Und das ist jenes Quentchen, das man nicht bezahlen kann, das sich einfach ergeben muss, das dann aber so ungeheuer viel wert ist. Ich für meinen Teil kann nur schwer wiedergeben, was mir das Lachen, das Strahlen vor allem der Frauen bedeutet hat. Da kam immer so ein bisschen Sonnenschein ins Zimmer. Mehr noch: Sie vermittelten mir das Gefühl, nicht einfach bloß irgendein Patient zu sein, sondern eben ich, also eine Person mit einem Leben, mit Ängsten, aber auch mit Hoffnungen. Nicht, dass wir darüber gesprochen hätten. Es war bloß das Gefühl. Aber dieses Gefühl, das weiß ich heute genau, das hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass ich durch jene finsteren Wochen kam. Anders wäre die Selbstbehauptung viel, viel schwerer gefallen.
Ich will mich jetzt nicht in Dankbarkeitsbezeugungen ergehen. Die kosten ja nichts. Davon bekommt unser Krankenhauspersonal wahrlich genug, auch in der Öffentlichkeit. Ich möchte bloß einfügen, dass ich im gesamten Gesundheitssystem die gleichen Erfahrungen machte: andere Krankenhäuser, CT und MRI, nicht zu vergessen Ordinationen niedergelassener Ärzte – stets dieselbe Freundlichkeit und Menschlichkeit.
Aber wie schon gesagt: Vom Dank können diese Frauen und Männer nicht abbeißen. Ihre Löhne gehören erhöht. Das ist in unserer Gesellschaft der sichtbare und handfeste Beweis der Wertschätzung. Zusätzlich wäre freilich noch etwas wichtig, sollte in unserer Welt der Rationalisierung und Einsparung ja nicht vergessen werden: Es braucht ausreichend Personal, um die hohe Qualität der Betreuung zu erhalten. Wenn diese Leute unter Druck kommen, Zeitnot, Stress – ja dann, das ist leicht vorherzusehen, dann wird’s bald vorbei sein mit persönlicher Betreuung. Aber mehr Personal kostet mehr Geld. Da wird sich also erweisen, wo unsere Prioritäten in Wahrheit liegen. Dass insgesamt nicht genug Geld vorhanden wäre, das wird man ja schwerlich behaupten können.
Lieber H. W. Valerian, vielen Dank für diesen einzigartigen, berührenden und intimen Text! – für alle AFEU-Autoren, Felix & Markus