Die gestrige Aufführung sei ein „Geniestreich“ gewesen, der Komponist habe sich regelrecht selbst übertroffen und nebenher noch das Rad neu erfunden. So liest man es sinngemäß immer wieder. Dieses Phänomen ist an sich nicht neu, nimmt aber im Moment bislang ungeahnte Ausmaße an. Es werden immer mehr Kritiken von Kritikern geschrieben, die weder Kritiken sind noch von Kritikern verfasst wurden. Vielmehr handelt es sich dabei um schriftliche Beifallsbekundungen, die sich an den Beifallsbekundungen des Publikums orientieren.
Solche „Kritiker“ schleichen nach Premieren noch ungeniert zur Premierenfeier, essen und trinken noch was aufs Haus und hören sich um wie das Stück bei den Anwesenden so angekommen ist. Auch der Beifall der Anwesenden nach der Aufführung gilt ihnen als beinahe objektiver Gradmesser wie gut denn das Stück nun tatsächlich gewesen sei. Dass bei der Premiere möglicherweise die Hälfte der Anwesenden Freikarten hatte weil entweder mit dem Gegenwarts-Komponisten verwandt, befreundet oder verschwägert und die andere Hälfte Journalisten sind, die sich ebenfalls an der vorherrschenden Stimmung orientieren, kommt dabei nur selten in den Sinn.
Es gilt mittlerweile das Motto der möglichst großen Unauffälligkeit was eine eigene, begründete Meinung angeht. Die Aufgaben eines Kritiker sind aber andere. Der Kritiker urteilt, ordnet ein, bewertet. Er bietet Zugänge zu komplexen Stücken an und gibt mögliche Leitfäden zur Hand. Er streicht rote Fäden heraus, die nicht auf der Hand liegen. Er nimmt an der Hand und geleitet durchs Dickicht der Zitate und Verweise. Er hat im allerbesten Falle mehr Kontextwissen und mehr Vergleichswissen als der meist unbedarftere Zuhörer.
Das heißt nicht, dass er dem Zuhörer und/oder Zuschauer ein Werk madig machen sollte. Er darf und soll das Werk aber in einen erweiterten Rahmen stellen. Er darf und muss widersprechen, wenn die Massenmeinung geschichtslos und kontextlos jubelt und bereits Dagewesenes als Neuartiges feiert. Damit wird es erst denkbar, dass das leidlich originelle Gegenwarts-Werk eine Brücke zu einem originelleren und gelungeneren Vergangenheits-Werk wird. Der Kritiker hat Fäden und Verbindungen nachzuweisen, wo der „normale“ Zuhörer nur Gegenwart und puren Schöpfergeist wahrnimmt. Er hat der rein gefühlsmäßigen Rezeption eine rationale und sachliche Ebene zur Seite zu stellen. Nicht damit nicht mehr gefühlt wird, sondern damit ein ganzheitliches Gefühls-Verstandes-Erlebnis ermöglicht wird.
Dieser immens wichtigen Aufgabe der Erweiterung der reinen Gefühlsrezeption steht der hier weiter oben beschrieben Unauffälligkeits-Kritiker gegenüber. Er widerspricht nicht, er stimmt ein. Er bildet keine oftmals notwendige Gegenstimme, er sieht sich als möglichst laute Stimme im Hurra-Jubel-Journalismus. Diesem geht es nicht mehr um Anleitungen zur möglichen tieferen und weitreichenderen Rezeption, sondern um das Überbieten der Superlative. Ist das Werk von dem vorhergehenden „Kritiker“ als „großartig“ beschrieben worden, hilft in der Aufmerksamkeits-Maschinerie nur noch diese Zuschreibung mit einem „Geniestreich“ oder „Meisterwerk“ zu übertrumpfen. Das ist keine Haltung des Kritikers, das ist eine Haltung des Marktschreiers. Die Lautstärke erhöht sich dabei zwangsläufig, weil im Wust des Meinungs-Konsenses nicht der leise und differenzierte Widerspruch, sondern die noch lautere Meisterwerk-Zuschreibung Aufmerksamkeit bekommt.
Als Reaktion auf diese Tendenzen kann eigentlich nur der Versuch einer möglichst großen Auffälligkeit als Motto ausgegeben werden. Diese Auffälligkeit meint nicht Zuspitzung um der Zuspitzung willen oder Übertreibung um der Übertreibung willen. Dieses Motto meint Wagemut und Widerspruchslust. Es meint tiefe Lektüre und genaues Hinhören mit dem eigenen Wissens- und Erfahrungshorizont als Kritiker. Es meint Meinung, die unmittelbar mit der Autorschaft des Kritikers verbunden ist.
Wenn sich der Kritiker als Autor und als schreibendes, denkendes und rezipierendes Subjekt offen legt und in die Texte einschreibt dann ist immer auch die Gefahr von fatalem Irrtum im Raum. Der Kritiker kann, trotz aller Redlichkeitsbemühungen, den falschen roten Fäden folgen. Auch mag ihm in manchen Augenblicken sein Ego im Weg stehen. Er mag außerdem vor lauter Kontextwissen nicht mehr zum Text und zum Kontext selbst gelangen. Doch all diese Risiken sind überschaubar und in Kauf zu nehmen, wenn man daran denkt, was ansonsten droht: Die autorlose, meinungsfreie und sich an der Massenmeinung orientierende Nicht-Kritik.
Titelbild: (c) Matt Tiegs, flickr.com






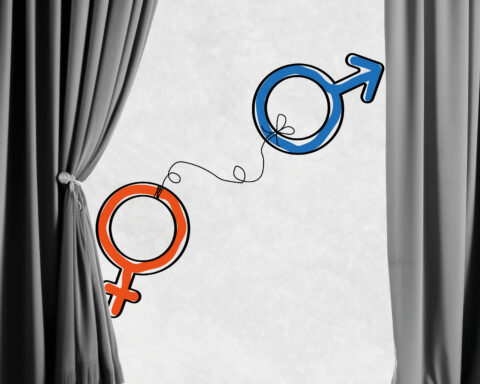





Was die Jubelbekundungen, die sich als Kritik ausgeben, betrifft, hast du wohl recht. Ich halte es aber für leichtsinnig, Zuschauer_innen a priori und en masse für unbedarft zu halten, auch wenn davor ein „meist“ steht.
Ich lese gern Kritiken, in denen steht, was genau dem Kritiker oder der Kritikerin besonders gefallen oder was sie gestört hat an der Darbietung. Auch etwas Hintergrund bzw. Querverweise können nicht schaden. Was ich nicht brauche, sind Anleitungen und/oder Belehrungen. Nicht leicht, aber nötig, das zu vermeiden.