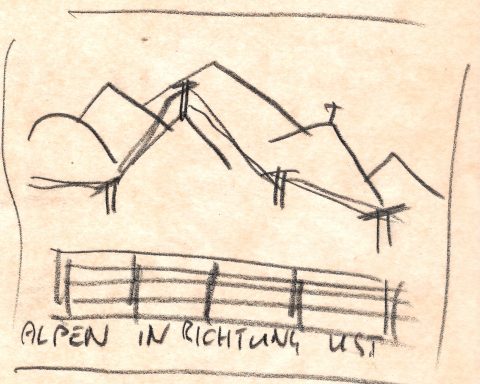1688 richtet William Molyneux an John Locke die Frage, ob ein Blindgeborener, der den Unterschied von Würfel und Kugel zu greifen gelernt hat, als plötzlich Sehend-Gewordener beide geometrische Körper allein durch deren Anblick unterscheiden könnte. George Berkeley reagiert 1709 in seinem Essay Towards a New Theory of Vision darauf und konstatiert, dass „spatial depth, as the distance that seperates the perceiver from the perceived object, is itself invisble“ (Berkeley, An Essay Towards a New Theory of Vision, 2008, 24). Er postuliert damit, dass Tiefenanschauung immer ein synthetischer Prozess des menschlichen Verstandes ist: „So that in truth and strictness of speech, I never see distance itself nor anything that I take to be at a distance. I say, neither distance nor things placed at a distance are themselves, or their ideas, truly perceived by sight.” (ebd.) Gleichsam als Affront wendet sich diese Feststellung gegen die in der Neuzeit als Norm rezipierte Schrift Kitāb al-Manāẓir (Schatz der Optik) des ägyptischen Philosophen Alhazen aus dem 11. Jahrhundert, die eine Visualisierung des Raumes belegen möchte. Alhazen legt dar, wie Licht und seine räumlichen Verkehrswege zwar nicht selbst darstellbar, Licht und Geometrie jedoch derselben Mathematik unterworfen sind, es folglich möglich sei, Raumanschauung sofern der notwendigen geometrischen Gesetzmäßigkeiten gewahr abzubilden. Maurice Merleau-Ponty kritisiert in seinem Hauptwerk Phénoménologie de la perception Berkeleys Ansatz der Negation des Raumes. Seine Auseinandersetzung fruchtet in eine Theorie der qualitativen und existentiellen Konnotation von Nähe und Ferne: „Unter allen Dimensionen ist sie [die Tiefe] gleichsam die ‚existentiellste‘, da sie sich in keiner Weise am Gegenstand selbst abzeichnet, vielmehr ganz offenbar der Perspektive, nicht den Dingen zugehört.“ (Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, 1976, 299). Darauf aufbauend konnotiert Merleau-Ponty den phänomenologischen terminus technicus Gestalt als Artikulationsmöglichkeit der dritten Dimension und definiert das strukturierende Erfassen von Gestalten als eine eigene Wissensform, insofern, dass das erkennende Bewusstsein beständig leiblich gebunden und zur Welt in einer konkreten Tiefendimension existiert. Gestalt zu geben ist deshalb immer ein existentieller Vollzug, im Letzten auch ein ganz persönlicher: Geb ich dir eine Gestalt? Gibst du mir eine Gestalt?
Titelbild: (c) pexels