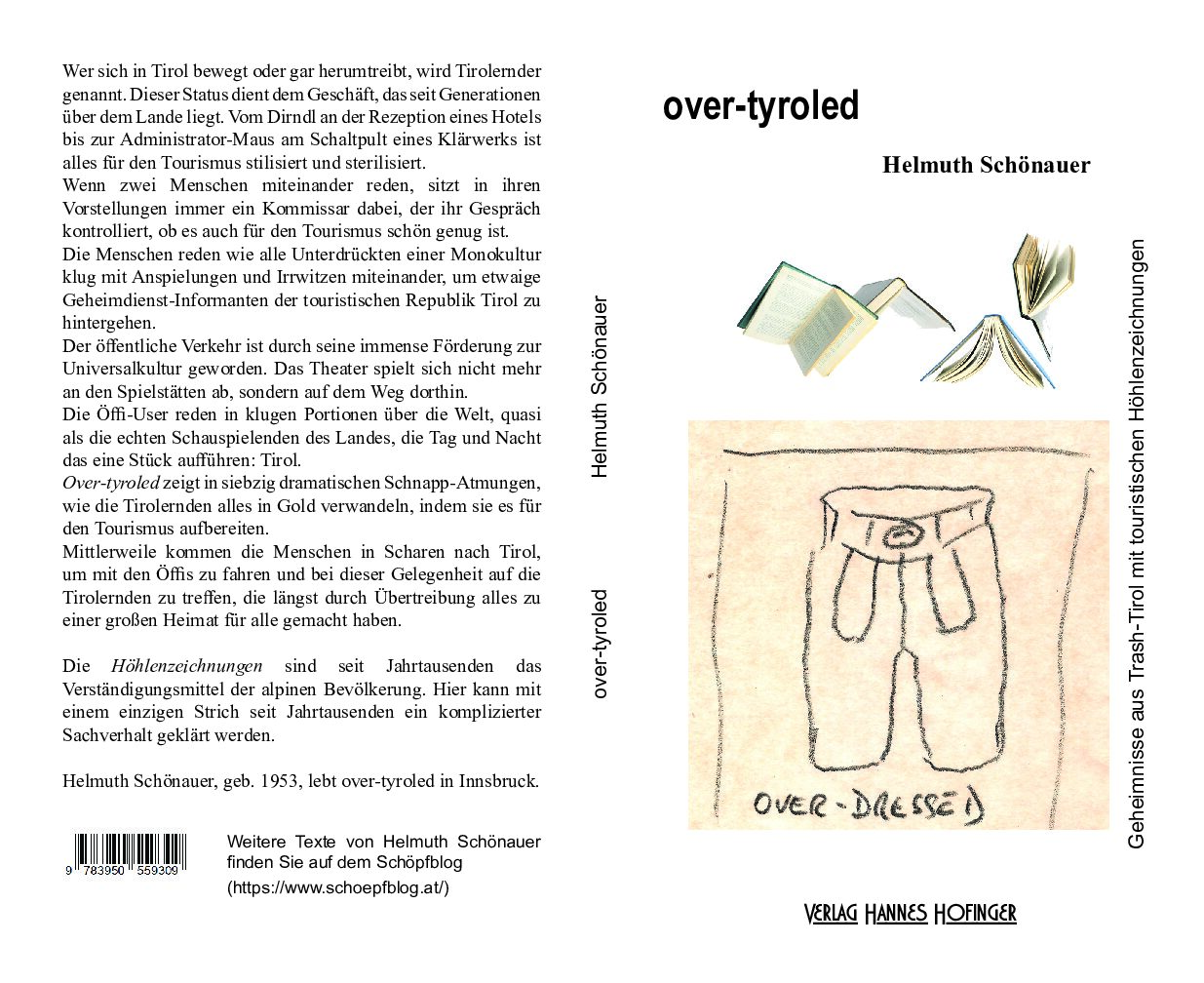Funkenflug
Emsig arbeiteten die Lautenistin Christina Pluhar und ihre musikalische Weggefährten am gestrigen Dienstag daran musikalischen Funkenflug zu generieren. Mit ihrem Ensemble und den beiden Sängern bot sie dazu einiges auf.
Dabei begann alles recht unspektakulär. Pluhar spielte und stellte sich als musikalische Leiterin des Abends zu keinem Zeitpunkt in den Mittelpunkt. Statt virtuose Solo-Exzesse zu zelebrieren bot sie ihren Mitmusikern den Untergrund zur Entfaltung und Improvisation. Ihre Theorbe bot den Groove des Konzertes. Beherzt griff sie zu Beginn der jeweiligen Werke in die Saiten, um sich dann wieder zurückzunehmen. Oft reichten ihr wenigen Töne. Vor allem aus den tiefen Tonlagen feuerte Pluhar gezielt und treffsicher.
Das präzise groovende Fundament führte dann aber in die Irre. So genau es Pluhar meist mit dem Ausgangsmaterial auch nahm, so viele Freiheiten ließ sie ihrem Ensemble. Das pausenlose Konzert war insgesamt auf Intensitätssteigerung ausgelegt. Diese Klimax sollte von keiner Pause unterbrochen werden. Alles endete mit einer peinlich anmutenden Rap-Einlage von Doron Sherwin, der sich bis dahin als Meister an der Zink erwiesen hatte.
Dabei war der Weg bis dahin fast vorgezeichnet. Neben feinsinnigen aber freien Interpretationen der Kompositionen von Cazzatti, Strozzi , Sances oder Monteverdi gab es stets auch viel Raum für freie Improvisation. Der Sänger Vincenzo Capezzuto bewies sich weiters im Laufe des Abends nicht nur als subtiler Sänger mit klarer und außergewöhnlicher Stimme, sondern als Tänzer. Das führte zu volkstanzähnlichen Szenarien, in denen zum Schluss gar ambitionierte Drehungen und wagemutige Sprünge erlaubt waren.
Doch nicht nur Capezzuto fiel aus dem Rahmen. Der Perkussionist Francesco Turrisi empfahl sich gleichermaßen als begnadeter Musiker wie als Akrobat. Sein Instrument bespielte er nicht nur eindrucksvoll, sondern warf es auch tollkühn in die Luft. Die Orgel ließ sich angesichts solcher im Rahmen der Alten Musik als Verrücktheiten zu bezeichnenden Ereignisse nicht lange bitten. Manche Passagen erinnerten an Jam-Sessions aus den 70er-Jahren. Statt Monteverdi schien man stellenweise Jon Lord zu huldigen.
Christina Pluhar sicherte sich aber natürlich ab. „Wem dies zu fortschrittlich erschient, dem überlasse ich es gerne, unsere Version als zu ´modern“ zu kritisieren […]“, führt sie im Programmbuch in Bezug auf einen kleinen „Scherzo musicale“ aus, der ebenfalls in das Programm eingearbeitet war. Diese leicht entschuldigende Haltung von Pluhar ist charmant. Zugleich stellt sie sich aber damit in eine Linie mit Monteverdi höchstpersönlich, dessen Kompositionen zu seinen Lebzeiten von konservativen Geistern als „zu modern“ gebrandmarkt wurden. Was läge also näher als diese damalige unerhörte und provokante Modernität in die Gegenwart der jetzige Aufführungspraxis zu holen? Jeder ob dieser Freiheiten und Interpretationen Irritierte wäre damit automatisch als reaktionärer Konservativer überführt.
Der Ansatz der Vergegenwärtigung und der Auslegung der Vergangenheit mit heutigen Mittel ist natürlich grundsätzlich löblich. Damit fangen sich Pluhar und Co. aber ein paar Probleme ein. Mit dieser Zugangsweise ist fortan nicht mehr die „Werktreue“ im Fokus. Die Frage, ob und wie ein Ensemble dem interpretierten Werk gerecht wird gerät in den Hintergrund. Ab sofort lastet der kritische Blick und das kritische Ohr auf den Mitteln der Vergegenwärtigung.
Das Ensemble legt sich sodann zwangsläufig mit dem modernen Jazz und den Methoden der freien Improvisation der Gegenwart an. Die zutreffende Behauptung, dass bereits zu Zeiten Monteverdis und in der Alten Musik generell viel improvisiert wurde, weil der Notentext nur „Skelett“ war, das mit Leben gefüllt werden musste, reicht nicht aus um sich stillschweigend aus diesem problematischen Kontext zu stehlen. Die improvisatorischen Zugänge und Mittel des Ensembles wirkten zum Teil altbacken und nicht auf der Höhe der Zeit.
Fazit
Man kann nur zum Schluss kommen, dass zu viel Gegenwart dieser „alten“ Musik nicht nur gut tut. Vor allem dann, wenn die behauptete Gegenwart auch schon der Vergangenheit zuzurechnen ist. Niemand erwartet sich, dass die an diesem Abend dargebotenen Werke brav-konventionell den kanonisierten Auslegungen angepasst gespielt werden. Niemand will ernsthaft, dass diese Werke nicht als freudvolle Anleitung zu Improvisationen dienen.
Man liebt „Alte Musik“ aber auch dafür, dass sie vergangene Zeithorizonte, Geschichte und Erzählungen in sich aufbewahrt. Aus der Gegenwart heraus sollen diese wieder in ihrer ganzen Pracht auferstehen und sinnlich hörbar gemacht werden. Öffnet sich diese Musik zu sehr, erzählt sie nur noch von der Gegenwart und nicht mehr von der „konservierten“ Vergangenheit.
Das geschah gestern. Vor lauter Funkenflug, feuriger Interpretation und Improvisation vergaß man etwas zu sehr auf die eigentlich im Mittelpunkt stehenden Werke. Der Funke sprang dabei, zumindest auf mich, nicht wirklich über. Es gab zu viel Freiheit und zu wenig Strenge. Es gab zu viel Effekt und zu wenig Subtilität. Der Funkenflug entfachte kein Feuer. Vermutlich weil zu viel Wert darauf gelegt wurde mit zu vielen Mitteln Funken zu erzeugen.
Titelbild: (c) Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, Knilling