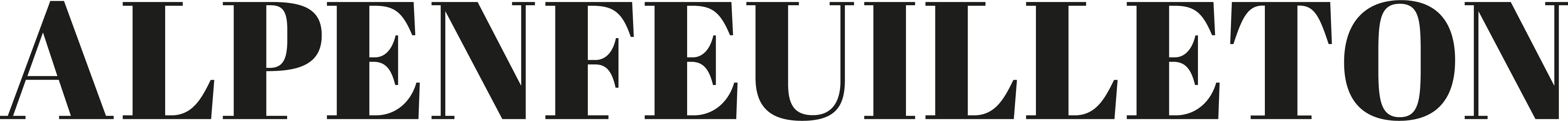Was bewegt einen Menschen dazu, seinen eigenen Leichnam nach Tradition der neuseeländischen Maori mumifizieren zu lassen, um ihn zum späteren Nutzen der Menschheit (etwa als Requisit für Theaterstücke) zu konservieren? Was sogar für einen Menschen des 21. Jahrhunderts seltsam oder gar verrückt erscheint, war jedoch nach der utilitaristischen Logik des Jeremy Bentham das Einleuchtendste auf der Welt.
Wunderkind
Jeremy Bentham wurde am 15. Februar 1748 in London geboren und interessierte sich schon früh für Bücher sowie politische und philosophische Ideen. Er galt als Wunderkind und wurde bereits 1760, im Alter von 12 Jahren, zum Studium in Oxford zugelassen – als, so sagte man damals, jüngster Student der Universität aller Zeiten. Dem Wunsch seines Vaters entsprechend lernte er später auf die Anwaltsprüfung; 1769 wurde er zur Vertretung vor Gericht zugelassen.
Doch die praktische Arbeit als Advokat sagte ihm nicht zu. Stattdessen begann er sich ab jener Zeit vermehrt mit Recht und Unrecht, Strafphilosophie, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft sowie Religion auseinanderzusetzen und darüber Bücher zu verfassen. Berühmt wurde der Engländer schlussendlich als Begründer des klassischen Utilitarismus, dessen Grundideen er im 1780 fertig gestellten (jedoch erst 1789 publizierten) Werk „An Introduction to the Principles of Morals and Legislation“ postulierte.
Glück maximieren
Seine zentrale These war, dass die Handlungen jedes mit Bewusstsein ausgestatteten Wesens von zwei Axiomen bestimmt waren: „the promotion of pleasure (happiness)“ und „the diminution of pain (suffering)“. Mensch als auch Tier – man beachte die für damalige Verhältnisse wohl revolutionäre Gleichrangigkeit – würden beständig danach streben, das persönliche Glück zu maximieren; also möglichst viel Vergnügen und möglichst wenig Pein zu erleben. Bentham dazu: „Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the other hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think; every effort we can make to throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it.“ Darauf aufbauend beschreibt Bentham zahlreiche Implikationen, vor allem für Wirtschaft und Arbeitswelt.
Grundidee war, dass jede einzelne Entscheidung nutzentheoretischen Überlegungen unterworfen sei, gleich wie trivial oder monumental diese einzelnen Entscheidungen seien mögen. So hätten sowohl eine Heirat oder auch der simple Brotkauf bei einem Bäcker jeweils eigene Nutzenfunktionen. Jeder Mensch strebt zunächst danach, seinen persönlichen Nutzen zu maximieren – doch dies sei nicht der optimale Pfad. Laut Bentham treten nämlich zwei Probleme auf: Erstens entstehen zwischen Individuen oft Interessenskonflikte (so gibt es viele Handlungen – wie zum Beispiel Diebstahl – die das Glück des einen steigern, das des anderen dafür reduzieren). Zweitens verfügen Menschen nicht über vollständige Information, um alle Konsequenzen ihres Handelns abzuschätzen.
Eine einfache Rechnung?
Der optimale Weg sei deshalb, die Gesamtwohlfahrt aller lebenden Menschen zu maximieren. Dies erinnert stark an das neoklassische Modell der Mikroökonomik, bei dem es die unter den Kurven liegende Fläche zu maximieren gilt. Zum euphorisierten ökonomischen Denken seiner damaligen Zeitgenossen können ebenfalls Parallelen gezogen werden. Bentham ging sogar so weit, Freud und Leid mathematisch zu quantifizieren, um sie kardinal vergleichen zu können: „A pleasure which lasts 1 hour is half as valuable as the same pleasure which lasts 2 hours. If a pleasure is certain to follow from a particular action, then it can be given a value of 1. If it will follow in half the instances, then it can be given a value of 1/2.“
Auch wenn er sonst als radikal liberal eingestellt galt (jegliche Form von Besteuerung lehnte er beispielsweise ab: „The imposition of taxation was a form of coercion, and all coercion was an evil in itself“), nahm Bentham den Staat mittels Gesetzgebung in die Pflicht, die richtigen Anreize zu setzen um die Handlungen der Menschen in eine derartige Richtung zu lenken, dass das Gesamtwohl maximiert wird. Zu jener Maximierung (oder auch „dem größtmöglichen Glück der größtmöglichen Zahl“) sei noch kurz eingeworfen: Es geht einzig darum, den aggregierten Gesamtnutzen zu maximieren; gleich, ob einzelnen Personen daraus ein gravierender Nachteil erwächst. Eine Handlung ist demnach dann moralisch richtig, wenn sie den aggregierten Gesamtnutzen maximiert.
Welche perfiden Blüten dies zuweilen trieb, verdeutlichen etwa folgende Überlegungen Benthams über Disziplinarmaßnahmen von Verbrechern, die es zu resozialisieren gilt: „Der bei den Züchtigungen produzierte Schmerz ist wie ein Kapital, das seinen Profit erwartet (…) Der Gesellschaft könnte ein großer Profit durch den erwachsen, (…) der die Wirkungen der verschiedenen Formen der Züchtigung untersuchen und die verschiedenen Abstufungen des Schmerzes angeben würde, etwa die unterschiedlichen Folgen von Quetschungen und Sehnenrissen, die man mit Schnüren- oder Peitschenhieben erzielt.“
Das ideale Gefängnis
Auch wenn Bentham – ebenfalls strikt aus nutzentheoretischen Überlegungen heraus – die Todesstrafe ablehnte, ersann er ein in seinen Augen optimales – nach heutigen Maßstäben wohl jedoch moralisch fragwürdiges – Gefängnismodell: Das Panopticon. Es war als runder Bau konzipiert, der es einem einzigen Wärter von einem zentralen Raum aus ermöglichte, die in Einzelhaft befindlichen Insassen zu überwachen. Diese hatten keine Möglichkeit festzustellen, ob man sie gerade beobachtete oder nicht. Außerdem, so schrieb er, würde sich die panoptische Architektur perfekt eignen, um in Manufakturen und Fabriken eingesetzt zu werden. Auf diese Weise würde man sich nämlich große Mengen an Wachpersonal einsparen. Gleichzeitig würde die beständige Angst, gerade bei der Arbeit beobachtet zu werden, den Menschen zu höchster Geschäftigkeit antreiben. In gewisser Weise liefert er hier den Startschuss für eine Überwachungsgesellschaft, wie sie zum Beispiel von George Orwell in seinem Roman „1984“ beschrieben wird – und die den Enthüllungen des Edward Snowden zufolge inzwischen wohl traurige Wirklichkeit geworden ist. Das wohl berühmteste tatsächlich realisierte Panopticon ist das Presidio Modelo auf Kuba, das auch heute noch besichtigt werden kann und in dem in den 1950ern Fidel Castro interniert war.
Vordenker des Feminismus
Die strikte und kühl-rationale Orientierung am aggregierten Gesamtnutzen aller Menschen hatte beileibe nicht nur Schattenseiten: Durch den kühlen Pragmatismus simpler Kosten-Nutzen-Rechnungen vermochte es Bentham, in moralischen Fragen vorurteilslos zu denken, und war so in vielen Ansichten seiner Zeit weit voraus: So etwa bei der Einräumung gleicher Rechte für Frauen, der Entkriminalisierung und breiten gesellschaftlichen Akzeptanz von Homosexuellen sowie dem Tierschutz.
Bentham starb im Jahre 1832, lange noch bevor viele seiner Ideen vor allem in westlich orientieren liberal und marktwirtschaftlich ausgerichteten Staaten Wirklichkeit geworden sind. Ob man menschlichen Nutzen und Bedürfnisse wirklich anhand von Kurven und Zahlen darstellen kann, sei dahingestellt – seinem gelebten Utilitarismus haben wir nun aber zumindest eine bestaunbare Mumie im University College London zu verdanken.