Mein angeschwitztes T-Shirt klebte an dem leicht aufgerissenen Lederrücksitz, als ich verzweifelt versuchte eine angenehmere Position einzunehmen. Wie ein Scheibenwischer auf niedrigster Einstellung wischte ich mir mit meiner Rechten im Zehn-Sekunden-Takt den Schweiß von der Stirn. Ein, zwei Mal entging mir ein kleines Tröpfchen. Es rann an meiner Wange herab und streifte den Winkel meines Mundes. Es schmeckte salzig, fast so wie der Ozean. Die Hitze dieser Großstadt war überwältigend. Vor allem in diesem kleinen, schwarzen Auto, in das sich zwangsläufig vier Personen reinquetschten. Wir waren gerade am Weg zur Fünften.
Manchmal starrte mir der Fahrer über den Rückspiegel tief in meine Augen. Er konzentrierte sich nur recht wenig auf die Straße, was im Abendverkehr einer Fünf-Millionen-Stadt auch nebensächlich zu sein schien. Die Fahrer der anderen Autos konzentrierten sich genauso wenig. Alle hielten ihr Handy in der Hand, weil sie es nicht schafften auch nur eine Autofahrt mit sich selbst zu verbringen. Was ein Mensch alles riskiert, um auch nur irgendwie für einen Moment der Einsamkeit zu entgehen. Irgendwie verstehe ich es. Als der Fahrer wieder seinen Blick senkte und auf die Fahrbahn richtete, atmete ich auf. Wenn Leute mich anstarren werde ich nervös. Die Intervalle meines Scheibenwischens verkürzen sich dadurch drastisch.
An einer roten Ampel gab es dank eines nahen Gebäudes ein wenig Schatten, der aber in der nächsten Häuserschlucht gleich wieder, durch einen der letzten verzweifelten Versuche der Sonne mich heute noch zu verbrennen, abgelöst wurde. Nach ein, zwei Ecken hielt der Fahrer vor einem heruntergekommenen Hochhaus. Ich saß rechts hinten im Fahrzeug und rückte in die Mitte, als ich sah, wie eine junge Frau aus dem Gebäude raus und zum Auto hin hastete. Sie hatte eine schwarze Handtasche dabei, die sie, als sie sich setzte, auf ihren Oberschenkeln ablegte und öffnete, um ihre Sonnenbrille herauszunehmen. Ich folgte ihrer Handbewegung und blickte dabei kurz in ihr Gesicht, als sie sich mit trägen Links-, Rechtsbewegungen die Brille auf der Nase zurechtrückte. Ihre Augen wirkten leer und müde, bis sie hinter den dunklen Gläsern verschwanden, die sie wie ein Schild von der Außenwelt zu schützen schienen. Schnell blickte ich wieder nach vorne, ich wollte, konnte nicht starren. Sie machte mich traurig.

Wir passierten gerade ein paar bellende Straßenhunde, die sich, wahrscheinlich zum letzten Mal am heutigen Tag, um einen Schattenplatz stritten, als die Frau ihr Handy aus der Tasche nahm. Sie entsperrte alle 30 Sekunden den Homescreen erneut, um zu sehen ob eine Nachricht gekommen war. Nach jeder einzelnen Kontrolle legte sie das Handy, mit dem Bildschirm nach unten gedreht, auf ihre Handtasche. Ich vermute sie tat es, um sich davon abzuhalten es erneut aufzuheben und zu kontrollieren, ob sie immer noch alleine war. Doch nach einer halben Minute griff sie wieder zum Handy und entsperrte es. Ja, sie war noch allein. Ich wischte mir abermals den Schweiß von der Stirn und berührte dabei mit meinem Ellbogen leicht die Schulter der Frau. „Perdon“ – „Entschuldigung“ zischte ich beschämt durch den Schlitz meines halb geöffneten Mundes und drehte dabei meinen Kopf zu ihr. Sie reagierte nicht. Noch beschämter drehte ich meinen Kopf wieder in seine ursprüngliche Position zurück.
Wir fuhren eine Straße entlang, die eine vierspurige Schneise durch die Hochhauslandschaft zog. Rechts von der Straße gab es einen kleinen, grünen Fleck mit einer verwelkenden Palme, auf dem sich ein Obdachloser gerade seine prall gefüllten Plastikbeutel zu einem Polster zurechtrückte. Zu meiner Linken saß ein älterer Herr mit schüttem Haar und Fußballtrikot, der mit einem kräftigen Klopfen auf die Kopfstütze des Fahrersessels signalisieren wollte, dass er bald aussteigen möchte. In diesem Moment vibrierte das Handy meiner Nachbarin. Ich las bei ihrer Konversation mit. Es war eine Nachricht ihrer Mutter gewesen. Sie wollte wissen wie es ihrem, frei übersetzt, „Großstadtmädchen“ so geht. Ihre Tochter tippte, dann etwas ein, was mir das Herz brach. „Me siento sola mami“ – „Ich fühle mich allein Mama“. Mit wiederholten, morseartigen Fingerdrücken löschte sie den geschriebenen Text und ersetzte es durch „Bien, y tu?“ – „Gut, und dir?“
An der nächsten Ecke stieg der Mann zu meiner Linken aus. Die Dame am Beifahrersitz würde auch bald ausgestiegen sein. Nur noch ich und sie. Sie tat mir so leid. Ich wollte mit ihr reden. Ich wusste nicht worüber, ich wusste nicht wie. Ich wollte sie irgendwie beschützen, rausziehen aus dem Loch der Einsamkeit, das mich auch gerade fest in seinen Zwängen hielt. Doch ich wählte es zu schweigen. Ich hatte meine Stimme so lang nicht mehr richtig verwendet, ich fürchtete mich davor sie zu hören. Wenig später war auch sie ausgestiegen und der Fahrer peilte meine Wohnung als letztes Ziel dieser Runde an. In der nächsten Runde würden sich wieder vier andere Passagiere aus dem Weg gehen, ohne dabei ihren Standort wechseln zu können. Bevor ich ausstieg bedankte ich mich mit einem einzelnen Wort und streckte ihm meinen Teil der Abmachung entgegen. Er starrte mir ein letztes Mal tief in die Augen. „De nada“ – „Gern geschehen“. Kurz daraufhin fuhr er los.
Mein kleines Apartment im sechsten Stock roch ein wenig, als ich die Tür aufsperrte. Ich hatte noch einen einzelnen Teller von meinem gestrigen Abendessen dastehen gehabt. Aus Versehen warf ich den Teller zu fest in die Spüle, sodass ein lauter Knall die Stille meines Zwei-Zimmerapartments mit Klang füllte. Im Kühlschrank müsste noch ein Bier sein, dachte ich mir. Es war noch eines da. Die letzten Sonnenstrahlen schienen gerade beim Fenster herein, als ich die Dose öffnete und zum Schluck ansetzte. Mein Handy befand sich in der Hosentasche, hatte aber beim Betreten der Wohnung kein Signal von sich gegeben, obwohl es sich mit dem WiFi verbunden haben müsste. Ich nahm einen Stuhl, setzte mich zum Fenster und sah dabei zu wie sich die Sonne schlafen legte. Eine Träne ahmte ihr das Sinken nach und lief einsam die Konturen meines Gesichts herab. Sie streifte dabei den rechten Winkel meines Mundes. Sie schmeckte wie der Ozean. Fast.


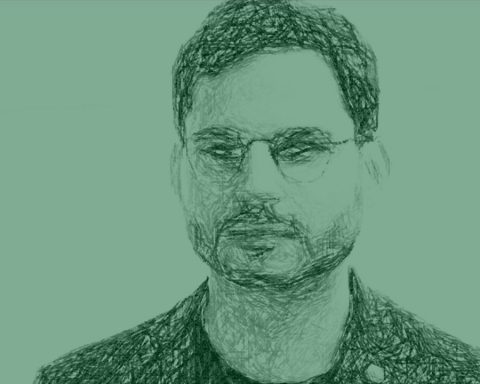

… Stimmt mich nachdenklich. Toll geschrieben David!